Wenn Sie mein Tagebuch oder das Logbuch meines Kollegen Stefan May bereits länger verfolgen, dann wissen Sie vermutlich, dass wir bei der Geldanlage auf zwei zentrale Prinzipien setzen: maximale Diversifizierung und Prognosefreiheit. Das machen wir nicht, weil wir es uns einfach machen möchten oder es nicht anders könnten. Nein, wir setzen damit auf elementare Erkenntnisse der Finanzmarktforschung: Niemand kann zuverlässig die Entwicklung der Finanzmärkte voraussagen. Jeder Versuch, bestimmte Regionen, Branchen, Einzelwerte herauszupicken, erhöht das Risiko, aber nicht zuverlässig die Rendite – wenn doch, ist es statistisch gesehen Zufall. Das Gleiche gilt für die ewig lockenden Versuche, optimale Ein- und Ausstiegszeitpunkte zu finden. Leider geht auch das in der Regel nämlich schief. Das ist belegt und deshalb machen wir es nicht.
Der Wunsch, „besser“ zu sein als der Markt, ist bei vielen Anlegerinnen und Anlegern natürlich trotzdem da und wird von Anbietern und Beratern auch bedient. Mit dem Verkauf von Produkten, die genau das versprechen: positives „Alpha“. So bezeichnen wir im Fachjargon den Teil der Rendite, der eben nicht durch die allgemeine Marktentwicklung bedingt ist, sondern durch das Geschick oder Können bei der Auswahl einzelner Unternehmen, Branchen oder Regionen, also durch aktives Management. Erreicht werden soll dieses positive Alpha durch besonders smarte Algorithmen, Künstliche Intelligenz oder den Einsatz toller Expertinnen und Experten. Allein: All das ändert eben nichts daran, dass die Finanzmarktforschung bei ihren Aussagen bleibt und sich immer noch sicher ist, dass der Wunsch nach zuverlässiger Outperformance ein Wunsch bleiben muss.
Auftritt der Superprognostiker
Umso interessierter war ich, als ich vor einigen Tagen im Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ über diese Überschrift stolperte:

Das Geheimnis der Superprognostiker (Der Spiegel 28/2024)
Damit hatten sie meine Aufmerksamkeit. Geht der ewige Wunsch nach der Glaskugel doch in Erfüllung? Müssen wir unser Anlagekonzept ändern oder ist gar unser ganzes Geschäftsmodell in Gefahr?
Und es wurde noch besser. Direkt im ersten Absatz kam der amerikanische Geheimdienst ins Spiel. Die US-Schlapphüte wollten die Qualität ihrer Vorhersagen verbessern. Mehrere tausend Freiwillige versuchten sich also – im Rahmen eines Programms einer anderen amerikanischen Behörde – über einen längeren Zeitraum darin, richtige Prognosen zu treffen. Dabei ging es beispielsweise um die Vogelgrippe, potenzielle Uranlieferungen von Land A an Land B oder Länder, die vielleicht die Eurozone verlassen würden. Nach einem Jahr wurden die treffsichersten zwei Prozent der Teilnehmenden zu „Superforecastern“ gekürt oder auf Deutsch zu „Superprognostikern“. Und das erinnert doch irgendwie an die „Superschurken“ aus den James-Bond-Filmen, oder? Leider wurde dieser Spannungsbogen aus Geheimdiensten und Superschurken – pardon, Superprognostikern – nicht ganz gehalten. Denn schon kurz darauf folgte die zumindest für mich und meine Agentenfantasien relativ langweilige Erkenntnis, dass es bei dieser Art von Prognosen vor allem darum gehe, möglichst unvoreingenommen an eine Frage heranzugehen. Expertentum schade sogar bisweilen. So antwortet einer der interviewten Superprognostiker dann auch auf die Frage nach seinem wichtigsten Arbeitsinstrument: „Google“. Es gehe darum, möglichst viele Informationen zu sammeln, abzuwägen, alle Sichtweisen zu berücksichtigen und sich nicht von Mehrheitsmeinungen beeinflussen zu lassen. Aktive Fondsmanager würden vermutlich noch Expertise und Zugang zu teuren Informationssystemen ergänzen. Womit wir wieder beim Thema Geldanlage wären.
Prognosen und Finanzmärkte
Interessanterweise tauchen die Finanzmärkte im Spiegel-Beitrag nur ganz am Rande auf, im Zusammenhang mit einer Prognose des Goldpreises und ohne Hinweis auf den (Miss-)Erfolg der Vorhersage. Und das finde ich wiederum sehr spannend. Warum ist das so? Vielleicht haben auch die Superprognostiker erkannt, dass Vorhersagen für die Börse nicht funktionieren. Oder vielleicht handelt es sich bei den Prognosen der Profis auch mehr um so etwas wie eine „Einschätzung der Lage“? Die kann in vielen Dingen natürlich hilfreich sein. Ergibt eine Lageeinschätzung ein erhöhtes Bedrohungsszenario, können Sicherheitsmaßnahmen verschärft werden. Tritt die Bedrohung dann doch nicht ein, gab es „nur“ erhöhte Aufwände – alles o. k.
Aber was soll ich beispielsweise mit einer Aussage wie „Mit einer Wahrscheinlichkeit von 60 % gibt es einen Crash“ machen? Raus aus dem Markt und dann von der Seitenlinie aus zusehen, dass der Crash doch nicht kommt? Keine gute Option, finde ich.
Vielleicht werden die Finanzmärkte im Artikel aber auch deswegen ausgeblendet, weil es hier einen weiteren Aspekt gibt, der Prognosen zusätzlich erschwert, wenn nicht gar unmöglich macht: eventuelle Rückkopplungseffekte. Wettervorhersagen werden beispielsweise immer besser. Supercomputer verarbeiten immer mehr Daten, simulieren Szenarien und erhöhen so die Qualität der Vorhersagen. Nur: Die Prognose, ob es morgen regnet oder nicht, hat keinen Einfluss auf das Wetter von morgen. An den Finanzmärkten wäre das anders. Wüssten wir, wie der Dax morgen schließen soll, würden wir schon heute entsprechend handeln. Damit wäre die Ausgangssituation der Prognose aber eine andere und die Vorhersage vermutlich hinfällig.
Was sagt die Wissenschaft?
Fondsmanager verdienen sich das Prädikat „Superprognostiker“ übrigens sicher nicht. Das zeigt eine beeindruckende Studie, auf die mich Stefan May, unser Leiter Anlagestrategie und „Finanz-Professor“, hinwies, als ich – angeregt vom Spiegel-Artikel – mit ihm über das heutige Tagebuch-Thema diskutierte. Ich würde sie eher als etwas schwere Kost bezeichnen, die ich Stefan normalerweise gerne für sein Logbuch überlasse. Weil sie aber so gut zu den Themen Prognosen und aktives Management passt, habe ich mich mal an die Wissenschaft herangewagt – bitte lassen Sie sich nicht von der etwas komplexen Grafik abschrecken.

Lese-Beispiele für die linke vertikale Achse: Ein Wert von 0 % bedeutet, dass der Aktienfonds in 20 Jahren keine Mehrrendite gegenüber seinem Vergleichsindex erzielt hat. Ein Wert von +2 % bedeutet eine Mehrrendite von 2 % p. a. gegenüber dem Vergleichsindex und ein Wert von -2 % eine entsprechende Minderrendite.
Interpretation der horizontalen Achse: Sie zeigt die Schwankungsbreite (Volatilität) der Mehr- bzw. Minderrendite. Je höher der Wert, desto heftiger waren die jährlichen Renditeausschläge nach oben und unten im Zeitverlauf. Je weiter rechts ein Fonds in der Grafik daher platziert ist, umso weiter lagen die einzelnen Jahreswerte der Mehr- oder Minderrenditen ober- oder unterhalb ihres entsprechenden 20-Jahres-Durchschnitts.
Das hier dargestellte Ergebnis stammt zwar aus den USA, die Ergebnisse sind aber auch auf andere Anlageregionen übertragbar. Das zeigt eine Vielzahl von Studien, die im Wesentlichen alle zum selben Ergebnis kommen.
Die Grafik zeigt das Resultat eines sogenannten Alpha-Signifikanztests. Dabei wurden nicht nur die Mehr- oder Minderrenditen der untersuchten Fonds gegenüber ihrem Vergleichsindex (die bereits oben erwähnten Alphas) untersucht, sondern auch, ob etwaige Anlageerfolge auf die Fähigkeiten des Managements zurückzuführen oder doch eher dem Zufall geschuldet sind.
Die Ergebnisse sind gleich in zweifacher Hinsicht erschütternd:
- Sage und schreibe rund 63 % der Fonds haben den Testzeitraum gar nicht überlebt. Sie wurden aufgelöst oder mit anderen Fonds fusioniert – in aller Regel aufgrund von Erfolglosigkeit. Denn von Investmentfonds, die aufgrund ihrer Erfolge geschlossen wurden, habe ich noch nie gehört. Lediglich rund 12 % aller Fonds (32 % der Überlebenden!) weisen über 20 Jahre hinweg überhaupt eine durchschnittliche Mehrrendite, d. h. ein positives Alpha, auf. Rund 25 % der Fonds (68 % der Überlebenden) zeigen dagegen Minderrenditen, sprich negative Alphas. Die Aktivitäten des Managements haben nicht nur nichts genützt, sondern im Grunde sogar geschadet, denn es wurden Anlageergebnisse erzielt, die schlechter waren als die Ergebnisse eines entsprechenden Vergleichsindex. Das kann auch für die nicht überlebenden Fonds unterstellt werden.
- Von den 12 % der Fonds mit Mehrrendite befindet sich lediglich ein einziger eindeutig im grünen (Signifikanz-)Bereich der Grafik. Hier befinden sich Fonds, deren Wertentwicklung sehr wahrscheinlich auf die Fähigkeiten („Skills“) des Fondsmanagements zurückgeführt werden kann.[1] Knapp am Signifikanzbereich, also auf der gestrichelten, ansteigenden Linie (die in der Grafik als „97,5 %-Signifikanzgrenze“ bezeichnet ist), liegt nur eine Handvoll Fonds. Alle anderen befinden sich mehr oder weniger eindeutig unterhalb dieser Signifikanzgrenze. Vereinfacht ausgedrückt: Die Mehrrenditen sind mit großer Wahrscheinlichkeit dem Zufall geschuldet.[2] [3]
Was können Sie aus diesem kleinen Deep-Dive in die Finanzmarktforschung also mitnehmen?
Erstens: Der Traum von der zuverlässigen Prognose der Börsenkurse von morgen bleibt wohl weiter ein Traum. Trotz Superprognostikern.
Und zweitens: Sie tun weiterhin gut daran, unserem prognosefreien Anlagekonzept zu vertrauen. Widerstehen Sie der Verlockung und den Versprechungen von den vermeintlichen Chancen aktiven Managements.









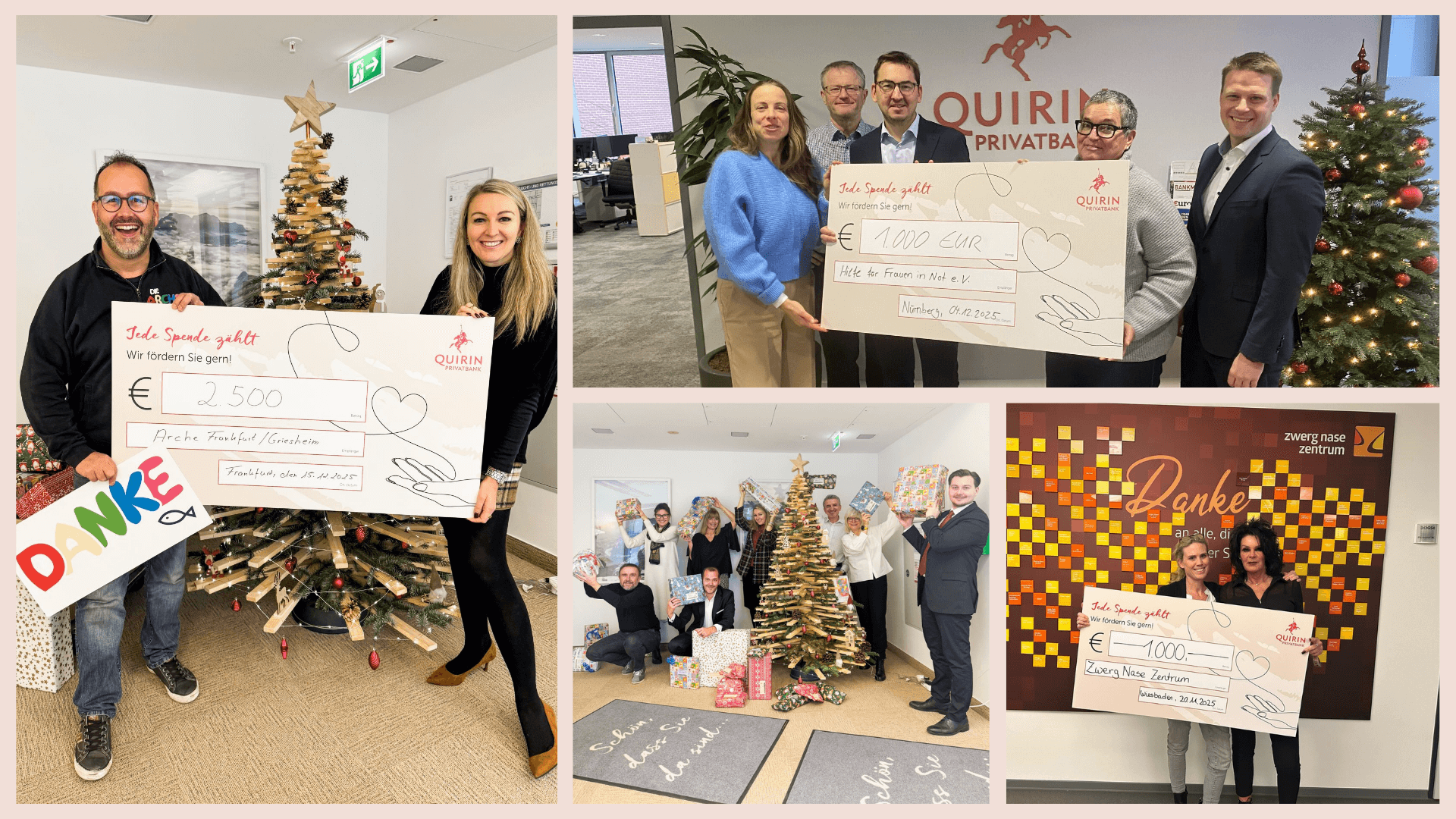

.webp)